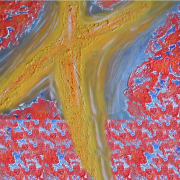Den Schmerz umwandeln in ein Juwel
– menschliche Leidbewältigung
„Verwundete Austern
lassen aus blutigen Wunden
eine Perle entstehen.
Den Schmerz, der sie zerreißt,
verwandeln sie in ein Juwel.“
(Richard Shanon)
Zur näheren Erläuterung dieses Leitmotivs soll so etwas wie eine Kindergeschichte beitragen, in der eine erfahrene weise Auster einen kleinen Auster-Nachkömmling ins Leben einführt und ihn den Sinn seiner Existenz verstehen lassen möchte. Zusammengerafft klingt das dann so:
Unter den Austern, so erklärt die weise Alte dem Kleinen, gibt es eine besondere Art, die zur Gattung der Perlmuscheln gehört. Die Perlmuscheln empfinden diese ihre Zugehörigkeit wie eine Art Auserwählung, denn sie haben eine Kraft, die die anderen Muscheln nicht haben: sie können Perlen bilden. „Das ist unser großer Reichtum, aber auch unser großer Schmerz“, so lautet die Erklärung der Alten, „denn ohne Leiden und Schmerzen gibt es keine Erwählung.“
Es verhält sich nämlich so: wenn sich die Muscheln öffnen, um Nahrung aufzunehmen, dann kann es geschehen, dass trotz aller Vorsicht ein Sandkorn, ein winziger Stein oder ähnliches mit in das Muschelhaus gelangt. Und weil die Muschel selbst einen sehr weichen, verletzlichen Körper hat, ist das jeweils ein großer Schmerz, wenn sich so ein Sandkorn in ihr Fleisch eingräbt. Das Sandkorn wird nie mehr wieder nach außen hin abgestoßen, doch dafür beginnt nun eine wunderbare, geheimnisvolle Kraft zu wirken, so dass aus dem Sandkorn eine Perle werden und wachsen kann. Der Organismus der Muschel muss sich nun anstrengen, – schon zum eigenen Schutz – Säfte zu entwickeln und auszustoßen, die das Sandkorn immer mehr umhüllen, so dass auch die Schmerzen für die Auster im Laufe der Zeit erträglicher werden. Schicht auf Schicht wächst, und je länger das Sandkorn in der Muschel ist, desto schöner wird die Perle. Doch davon sieht niemand etwas, das wird erst sichtbar, wenn die Muschel tot ist. Dann zeigt sich, wenn man das Gehäuse öffnet, wie viele Sandkörner darin unter Schmerzen zu Perlen werden konnten und wie reich ein solches Leben war. Die Muschel selbst erfährt sozusagen nur die negative Seite dieses Werdens und erleidet den Schmerz des eindringenden Fremdkörpers. Aber würde sie den Schmerz des in sie eindringenden Korns nicht zulassen und ausgestalten, – würde sie sich erst gar nicht öffnen, – dann verfehlte sie den Sinn ihres Daseins, und ihr Leben bliebe arm und leer. Wenn aber der Schmerz, der in die Perlmuschel eindringt und sie verletzt, bejaht und angenommen wird, – wenn er gleichsam zu ihrem Leben gehört, – dann kann sich Verwandlung anbahnen und eine kostbare Perle entstehen. „Den Schmerz umwandeln in ein Juwel“ – in einem ersten Schritt: durch Annahme der Leiderfahrung und des Schmerzes.
Das alles kann uns ein Gleichnis werden bei dem Versuch, den Sinn von Leiden und Schmerzen zu ergründen, – auch wenn uns der Sinn letztlich verschlossen bleibt. „Ich weiß nicht um den Sinn dessen, was mich als harter Schicksalsschlag trifft“, so sagte einmal Dietrich Bonhoeffer zur Sinnfrage, „aber ich weiß um den, der den Sinn kennt,“
Dennoch sind die vielen Fragen, die so alt sind wie die Menschheit und von Generation zu Generation immer wieder neu auftauchen, damit nicht einfach abgetan: Warum dieses schreckliche Leid, – warum diese Kriege, diese unheilbaren Krankheiten, diese Schmerzen und Wunden? Womit habe ich das verdient, wofür will Gott mich strafen? Wie kann Gott das zulassen? – „Warum“, – so fragte Bischof Franz Kamphaus „warum diese verheerenden Naturkatastrophen, die Erbeben und Seebeben, die Hunderttausende von Toten? Schreit nicht das ganze Elend zum Himmel? Schärfer noch“, so Bischof Kamphaus, „schreit es nicht gegen den Himmel, gegen Gott“, den wir doch den Gerechten nennen, aber ebenso den Gütigen und Barmherzigen, „Gott ist die Liebe“, heißt es im 1. Johannesbrief. Wie lässt sich das alles miteinander vereinbaren? Was ist das für ein Gott? Die Psalmen sind voll solcher Schreie und Fragen, und Jesus am Kreuz hat sich nicht gescheut, darin einzustimmen. „Warum, mein Gott, warum – hast du mich verlassen?“ Es ist schon viel gewonnen, wenn wir uns auf diese Warum- Fragen einlassen, wenn wir sie nicht verdrängen oder sie schönreden, sondern uns ihnen stellen und sie anschauen. Um es gleich vorwegzunehmen: es gibt keine glatten Antworten auf diese abgründige Gottesfrage. Auch die Theologie hat sie nicht. Die sogenannte Theodizeefrage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts aller Weltenübel und der oft so unbegreiflichen menschlichen Leiden, bleibt offen. Wir müssen dieses Dunkel aushalten, das gehört zum Glauben. Diese dunklen Fragen aushalten, auch wenn sie keine Antwort finden. Dennoch lässt sich auch in diesem Dunkel Licht aufspüren, das uns vom Evangelium her geschenkt wird.
„Warum?“ das ist also nicht nur unsere Frage, das ist auch eine Frage, die Jesus am Kreuz an „seinen Gott“ gerichtet hat. Er hat diese Frage nicht analysiert, hat sie nicht durchschaut, „gewusst wie“ – er hat sie durchlitten und hat sie ausgehalten ohne eine greifbare Antwort. Und damit stehen wir letztlich vor dem Geheimnis Gottes. Die Unbegreiflichkeit des Leides jeglicher Art weist uns hin auf die Unbegreiflichkeit Gottes. „Gott in seinem unerforschlichen Ratschluss“, wie leicht sagt sich das! Karl Rahner hat versucht, für diese Erfahrung Worte zu finden und sagt: „Es gibt kein anderes Licht, das die finsteren Abgründe des Leides erhellt, als Gott selbst. Und ihn findet man nur, indem man ja sagt zu seiner Unbegreiflichkeit, ohne die er ja nicht Gott wäre.“ Ihn in seiner Unbegreiflichkeit anzuerkennen, das ist gleichsam von uns gefordert, wenn wir in die Unbegreiflichkeit und Ungeheuerlichkeit des Leidens geführt werden und dabei unser vielleicht allzu naives Bild vom „lieben Gott“ zusammenbricht.
Unser gewohntes Gottesbild kann total in Frage gestellt werden, wenn die Unbegreiflichkeit und Ungeheuerlichkeit des Leidens uns einholt. Das mag deutlich werden bei einem Blick auf das Grauen in Auschwitz, von woher uns dieser Vorfall überliefert ist. Ein Junge soll gehängt werden, weil er Untergrundnachrichten im Lager weitergegeben hat. Alle Blockinsassen müssen zusehen, wie er lebendig am Pfahl hochgezogen wird und den qualvollsten Todeskampf erleidet. Einer von ihnen ruft leise anklagend: „Wo ist denn jetzt Gott, wo ist er?“ Und der Jude Elie Wiesel erinnert sich daran, wie er da in sich eine Stimme vernommen und gleichsam als Antwort gehört habe: „Dort oben hängt er – am Galgen.“
Gott am Kreuz, Gott mitten in unserem Leiden. – er verwandelt unser Leid nicht, in dem er es hinweg nimmt, sondern indem er auf den untersten Grund der Not zu uns herabsteigt. Gott ist kein bequemer und berechenbarer Gott. Vielleicht fängt Glaube in fast verfremdeter Form, – wie es in Auschwitz den Anschein hatte, – erst dort an, wo Verzweiflung anfängt. Vielleicht sollten wir das einmal aushalten, das Gefühl, als habe Gott uns fallen gelassen, – ins Bodenlose, Ungewisse, ohne Licht und Trost. Wo Glaube eigentlich sinnlos geworden ist und Liebe lächerlich, wo es keinen Menschen mehr gibt, geschweige denn Gott, dort, ganz unten, an einem bestimmten Ort und Zeitpunkt, da wartet er dann, um uns aufzufangen und nicht mehr loszulassen. Vielleicht geht es nur um diesen Glauben, der durchhält, um den Durchhalteglauben: das Unbegreifliche und Ungeheuerliche stehen lassen, die Durchkreuzung unserer Lebenspläne akzeptieren, die dunklen Flecken unseres Lebens annehmen und sie Gottes verwandelnden Händen anvertrauen. Vielleicht ist dieser Durchhalteglauben das einzige, was wirklich zu tragen vermag. Hier ist kein Raum mehr für ein allzu naives Bild vom „lieben Gott“, hier wird es heilsam verändert.
Ein „Bild von Gott“ – gibt es das? Was geschieht, wenn uns die Frage bewegt, wie denn Gott zu glauben und zu denken ist? Haben da nicht die meisten Menschen gleich ein Bild vor Augen, ob positiv oder negativ? Dem Volk Israel war am Sinai geboten worden, sich kein Bild von Gott zu machen, da es seinen Gott nicht in materiellen Darstellungen suchen und sich ihm so nahe wissen sollte, sondern vielmehr anfanghaft schon „im Geiste und in der Wahrheit“. Das schließt nicht aus, dass wir in unserer Gotteserkenntnis auch immer wieder ausgehen müssen von Vorerfahrungen, die wir zumal am Anfang unseres Lebens mit den Schlüsselfiguren haben machen müssen. Wo ein Mensch in positiven liebevollen und gesunden Verhältnissen hat aufwachsen dürfen, prägt das unbewusst natürlich auch sein Verhältnis zu Gott. Er weiß sich einfach geliebt und von Grund auf angenommen. Wo aber ein Mensch von Anfang an in eine lebensverneinende Umwelt hineingeboren wurde, kann sein unbewusstes Gottesbild nicht anders als negativ entstellt, ja, man muss schon sagen, verzerrt und insofern „dämonisch“ geprägt sein, als es mit dem „wahren Gott“ nichts mehr zu tun hat. (Karl Frielingsdorf SJ, „Dämonische Gottesbilder.“)
Das bei den Menschen am meisten vorkommende negative Gottesbild ist das des strafenden Richtergottes, des angstmachenden, furchterregenden Super-Gottes, der auch in der kirchlichen Verkündigung, noch im vorigen Jahrhundert, nicht selten bemüht wurde und heute noch mehr als man annehmen mag, die Gottesvorstellung vieler prägt. Dieser strenge Tyrann duldet keinen Widerspruch, kennt keine Güte, kein Erbarmen. Der Sünder muss unerbittlich büßen. Manche kennen wohl noch die Sequenz aus der früheren Totenliturgie „Dies irae“ – Tag des Zornes. „Und ein Buch wird aufgeschlagen, streng darin ist eingetragen alle Schuld aus Erdentagen . . .“ Oft liegen solchen negativen Gottesbildern problematische Vaterbeziehungen von Kindheit an zugrunde, die von Angst und Misstrauen geprägt sind.
Wie wird ein solcher Mensch mit einer Leiderfahrung umgehen, – fast umgehen müssen, etwa ausgehend von dem Gedanken: Gott ist ein strenger Richter aller Sünder, – er bestraft das Böse und vergilt nach den Taten. Demnach muss ja der Mensch, der unter solchen Bedingungen ohnehin ein Skrupulant geworden ist, sein Leid selbst verschuldet haben unter der Last all des Bösen. Wozu mache ich Gott, wenn ich ihn zum großen Strafrichter erkläre. Welche Absichten unterstelle ich ihm, wenn ich alles Missgeschick als Strafe Gottes deute. Das kann doch nicht stimmen!
Ein weiteres vorherrschendes „dämonisches Gottesbild“, das mit dem des Richtergottes zusammenhängt, ist das des Buchhalter- oder Gesetzesgottes. Der Buchhaltergott ist in der Vorstellung des Betroffenen ein gefühl- und herzloser Dämon, ein Robotergott, der jeden Fehler und jedes Vergehen des Menschen gegen das Gesetz automatisch aufschreibt für die große Endabrechnung beim letzten Gericht. Eine bedrohliche Überwachungsinstanz, „ein Auge, das alles sieht“ und durchschaut. Die Folge: Christsein vollzieht sich als ein Frondienst in einem unüberschaubaren Gewirr von Verboten und Geboten, die niemals erfüllt werden können. Immer bleiben unbezahlte Rechnungen offen, die wiederum Schuldgefühle erzeugen und das Leben zur Qual machen. Wie muss ein solcher Mensch mit Leiden und Schmerzen fertig werden können?
Diese Aufzählung dämonischer Gottesbilder mag genügen. Sie sind eben keine wirklichen „Bilder von Gott“, sondern vielmehr von Dämonen, die mit dem wahren Gott nichts zu tun haben. Im Unbewussten des Menschen sind sie verankert und werden von dort auf Gott projiziert. Man muss sich das immer wieder einmal ins Bewusstsein rufen, denn keiner ist ganz frei von falschen Vorstellungen.
Wie finden wir aber heilende „Gottesbilder“, an denen wir uns bewusst orientieren können? Das Evangelium hält sie uns bereit, vor allem in seinen Gleichnissen, die zu seinem „Urgestein“ gehören. Einige gibt es darunter, mit denen uns Jesus nach Meinung der neueren Theologie (Eugen Biser) nicht nur ein „Bild“, sondern sogar ein „Selbstporträt“ hat hinterlassen wollen. Im 13. Kapitel bei Lukas identifiziert sich Jesus so eindeutig mit dem fürbittenden Weingärtner, dass er in sein Herz schauen lässt und sich auf diese Weise selbst porträtiert. Da kommt der Besitzer des Weinbergs schon im dritten Jahr, um bei dem dort angepflanzten Feigenbaum nach Früchten zu suchen. Und wieder findet er keine. Verärgert darüber befiehlt er seinem Weingärtner: „Hau ihn um! Was soll er noch weiter den Boden auslaugen?“ Doch aus unerklärlichen Gründen hängt das Herz des Weingärtners gerade an diesem ertraglosen Baum. Er widerspricht nicht förmlich, aber er bittet um Aufschub. „Lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will den Boden umgraben und Dünger einlegen. Vielleicht bringt er dann doch noch Früchte.“ Mit sozusagen verzweifelt argumentierender Liebe setzt er sich für den Baum ein, obwohl ihm die Rettungsaktion ja auch fraglich sein muss. Aber selbst wenn alle Liebesmüh’ nichts bringt, will er mit dem ergangenen Befehl nichts zu tun haben. Und so betont er: „Wenn das alles nichts nutzt, dann magst du ihn umhauen lassen“ – mit anderen Worten: nicht ich werde das tun! Eine nahezu törichte Liebe wird da erkennbar, die sich von keiner Enttäuschung zurückhalten lässt. Tröstlich, denn dieser Feigenbaum, um dessen Heil oder Unheil es geht, steht überall, auch mitten unter uns und mitten in uns.
Oder ein heilendes Gottesbild im Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn. Da hat ein junger Aussteiger das Vermögen seines Vaters auf liederliche Weise durchgebracht und sitzt nun total heruntergekommen bei den Schweinen. Was ihn dann zur Rück- und Umkehr veranlasst, ist zunächst gar nicht sein Schuld- und Sündenbewusstsein, schon gar nicht der Gedanke an die väterliche Liebe, – der erste Anstoß zum Umdenken erwuchs aus rein existentieller Not: „Ich komme hier vor Hunger um und bei meinem Vater gibt es Brot im Überfluss.“ Erst dann steht er auf, und dabei reift auch sein Schuldbekenntnis, – aber erst dann: „Ich habe gesündigt. . .“ Doch der Vater lässt ihn gar nicht ausreden, fällt ihm törichterweise um den Hals und küsst ihn und macht ihn zum Mitbesitzer aller seine Güter. Torheit und Bedingungslosigkeit der Liebe.
Ein heilendes Gottesbild übermittelt uns auch ein Weihnachtsgedicht von Rudolf Alexander Schröder. Da heißt es in der letzten Strophe:
„Es geht uns nicht um bunten Traum,
um Kinderlust und Lichterbaum.
Wir bitten: blick uns an,
und lass uns schau‘ n dein Angesicht,
drin jeder das, was ihm gebricht,
gar leicht verschmerzen kann.“
Was kann uns alles „gebrechen“: Leiden, Schmerzen, Verluste, Kränkungen, . . . und doch: „leicht verschmerzbar im Leuchten dieses Angesichtes!
Heilende Gottesbilder sind Bilder, die im Anschauen die Wunden als Quelle meiner Schmerzen heilen, mir im Leid helfen können, wenn ich mich ihnen aussetze. Heilen wie die Verletzung, die die Auster erleidet, wenn ein Fremdkörper in sie eindringt. Da werden von woanders her Kräfte wach, die aus dem Schmerz unmerklich ein Juwel machen.
Zum Schluss soll kurz noch eine heute vielleicht schon nicht mehr so bekannte Persönlichkeit in den Blick genommen werden, der Philosoph Peter Wust, der 1940 in Münster nach einem überaus leidvollen Leben und qualvollem Sterben mit 56 Jahren seinem schweren Leiden erlag, ohne von ihm besiegt worden zu sein. Schon in seiner Kindheit lernte er bitterste Not und Enttäuschung kennen. Im Saargebiet als ältester Sohn eines Siebmachers geboren, war dem so hochbegabten Jungen zunächst jegliche Ausbildung verwehrt, bis der Pfarrer seines Heimatortes ihm Privatunterricht erteilte und ihm zum Gymnasium und Studium verhalf in der Hoffnung, dass er zum Priestertum fände. Aber dann quälte ihn über längere Zeit große Glaubensnot, so dass er das Priestertum als Berufsziel aufgab und das des Gymnasiallehrers anstrebte, was ihm zumal die Eltern lange Zeit verübelten. Nach einer überaus fruchtbaren Zeit geistiger Kontakte in Köln wurde er 1930 als Professor der Philosophie an die Universität Münster berufen. Wenngleich er dort auf wenig Aufgeschlossenheit stieß und sich einsam fühlte, saß ihm die Jugend aller Fakultäten zu Füßen, die Hörsäle waren zu klein. Das Geheimnis seiner Persönlichkeit lässt sich kaum ergründen. Sein Thema ist „Menschwerdung, ewige Menschwerdung.“ – „Mit dem Leiden fängt es an, das Menschwerden“, so die Aussage Peter Wusts, und er hat den Erweis selbst erbracht, denn sein Leben vollendete sich in großem Leiden. Als er an Gaumenkrebs erkrankte, der sich immer mehr ausbreitete und ihn schließlich dem Hunger auslieferte, der Sprache beraubte und ihn mit beständigen wütenden Schmerzen befiel, da brach er zunächst in erschütternde Klage aus, als ihm sein Ende zur Gewissheit wurde:
„Alles ist mir im Leben danebengegangen, überall habe ich Fiasko gemacht. Ich habe wirtschaftlich nichts erreicht. Meine Familie hat keine sichere Existenz. Wissenschaftlich habe ich nichts erreicht. Philosophisch habe ich nur in „Ungewissheit und Wagnis“ das Eigentliche sagen dürfen. Alles was ich gesagt habe, ist Spreu, nicht das Wesentliche. Ich habe religiös nichts erreicht. Ich stehe vor einer zerschossenen Bastion und hisse die weiße Flagge. Ich kann mich nur auf Gnade und Ungnade der Barmherzigkeit Gottes ergeben. Gott mag nun kommen. Er mag mit mir fertig werden.“ Hier bricht der Schmerz eines unendlich schweren Lebens vor seinem Ende noch einmal in aller Härte auf. Er hat ihn zugelassen, seine Unbegreiflichkeit eingeklagt vor dem geheimnisvollen Gott. Aber unmerklich hat sich in der letzten Phase seiner Lebenszeit ein wunderbare Wandlung vollzogen: die Wandlung seines Lebens-schmerzes in eine kostbare Perle. „Während die Jahre seines Wirkens als akademischer Lehrer der Darstellung und Deutung menschlicher Daseinsunruhe gehörten, erhielt sein Lebenswerk die letzte Vollendung durch sein in gläubiger Hoffnung getragenes Leiden,“ so formuliert es eine Würdigung Peter Wusts. Davon geben auch seine letzten Worte Zeugnis, die er auf Drängen seiner anhänglichen Schüler schrieb, ehe ihm alle Ausdrucksmöglichkeiten genommen wurden:
„ . . .und wenn Sie mich nun fragen sollten, bevor ich jetzt gehe und endgültig gehe, ob ich einen Zauberschlüssel kenne, der einem das letzte Tor zur Weisheit des Lebens erschließen könne, dann würde ich Ihnen antworten: ‚Jawohl!’ Und zwar ist dieser Zauberschlüssel nicht die Reflexion, wie Sie es von einem Philosophen erwarten möchten, sondern das Gebet. Das Gebet, als letzte Hingabe gefasst, macht still, macht kindlich, macht objektiv. Ein Mensch wächst für mich immer tiefer hinein in den Raum der Menschlichkeit, wie er zu beten imstande ist. Die großen Dinge des Daseins werden nur den betenden Geistern geschenkt. Beten aber lernt man am besten im Leiden. Der Mystiker Heinrich Seuse weist eindringlich hin auf den Adel des zeitlichen Leidens und seinen Zusammenhang mit dem Gebet. Damit will ich mein Abschiedswort an Sie, meine lieben Schüler und Schülerinnen, schließen. Beten Sie in diesen Tagen noch einmal in ganz besonderer Weise für mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und grüße Sie herzlichst mit einem kindlich-frohen „Auf Wiedersehen!“ Ihr ergebenster Peter Wust.“
Sr. Teresa Tromberend OSB
– menschliche Leidbewältigung