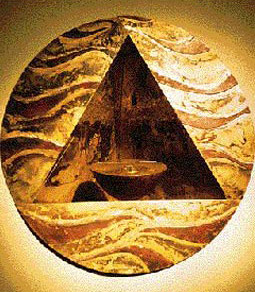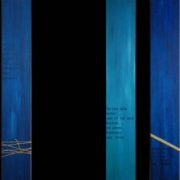„Am Aschermittwoch ist alles vorbei…“ heißt es in einem bekannten Karnevalsschlager. Ich wage zu widersprechen: Am Aschermittwoch fängt alles neu an! 40 Tage sind es von jetzt an bis Ostern. Die Kirchen legen uns in dieser (Fasten)-Zeit nahe, altbekannte Gewohnheiten einmal zu überprüfen, uns von echten oder vermeintlichen Zwängen zu befreien, Überflüssiges loszulassen, um zum Kern, zum Eigentlichen des Lebens, vorzustoßen. Entschlackung an Körper, Geist und Seele tut gut und oftmals auch not. Sich öffnen für Neues, vielleicht aber auch für Altes, das nur zugeschüttet war. Die Glut unter der Asche neu entfachen und das eigene innere Feuer wieder zum Leuchten bringen. Das ist für mich der eigentliche Sinn der Fastenzeit. In diesen Wochen können wir Gott, dem Urgrund unseres Seins, wieder näherkommen oder zumindest kann die Sehnsucht und Suche nach ihm in uns wieder neu wach werden. Wie wir diese Zeit im Einzelnen gestalten, ist jeder und jedem von uns überlassen. Da gibt es kein Patentrezept. Wichtig ist nur, sich einen Punkt einmal ganz konkret vorzunehmen. „Sieben Wochen ohne…“ heißt eine Initiative, in der sich Menschen seit einigen Jahren zusammenfinden, die die Fastenzeit nicht sang- und klanglos verstreichen lassen, sondern sie bewusst nutzen wollen. Sie teilen die Erfahrung, dass weniger mehr sein kann, dass Verzicht Gewinn bringen kann. Dieser Tage hörte ich im Autoradio eine Sendung, in der berichtet wurde, dass Facebook, Instagram und Tik-Tok-Nutzende in der Regel weniger glücklich sind als andere Menschen. Warum? Ich vermute, weil sie sich täglich neu mit anderen vergleichen, weil sie neidisch und eifersüchtig werden, wenn sie sehen und hören, was andere tun, können oder haben. Das Sich-Vergleichen gehört im Mönchtum, d.h. bei Klosterleuten, zu den „Ursünden“ schlechthin, weil es wie von selbst Unfrieden, Zwietracht und Streit mit sich bringt. Als Heilmittel dagegen haben weise Altväter und Altmütter die Dankbarkeit empfohlen. Wer dankbar sein kann – für das, was er ist, was er kann und was er hat -, der braucht nicht auf andere zu schielen, der ist zufrieden, d.h. in Frieden mit sich und der ihn umgebenden Welt. Wie wäre es, einmal 40 Tage lang auf das Sich-Vergleichen zu verzichten? Ich bin überzeugt, dass wir dann vieles mit neuen Augen sehen würden. Und noch mehr: unsere Welt würde Schritt für Schritt friedlicher und lebensfreundlicher werden.
Sr. Philippa Rath