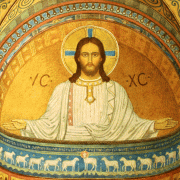Einleitende Gedanken zu den Ich-Bin-Worten
Sobald ein Kind sagen kann: “Ich bin Paula…“, hat es einen entscheidenden Entwicklungsschritt in seinem Leben getan. Es hat erkannt, dass es eine eigenständige Person ist, ein ICH, unterschieden vom DU, das ihm gegenübersteht. Die auf den ersten Blick so unscheinbare Existenzaussage „Ich bin“ berührt den Mittelpunkt menschlichen Begegnens. Jede Begegnung mit einem Unbekannten zielt zunächst auf die direkte oder indirekte Frage: Wer bist Du? Wie bist Du? Das Sein des anderen, sein Ich, wird über die Entwicklung der Begegnung ebenso entscheiden, wie die Art und Weise der Begegnung. Viele Mosaiksteinchen sind es, die die Formel „Ich bin“ inhaltlich füllen und mitteilbar machen. Menschen mühen sich seit jeher darum, denn vom Kontakt mit anderen, von der Begegnung leben wir. Kein Mensch mit seinem individuellen „Ich“ bleibt in einer Gemeinschaft ohne Wirkung, er prägt und gestaltet sie mit, jedes Ich bekommt in der Gemeinschaft eine zusätzliche Dimension. Dabei ersehnen wir Begegnungen bestimmter Art, andere meiden wir lieber. Jede Begegnung hat Konsequenzen unterschiedlicher Tragweite. Die einen verblassen nach einiger Zeit, andere prägen Menschen und Kulturen. So ist die Erkenntnis und der Austausch des „Ich bin“ von Menschen für das Gelingen menschlichen Lebens unabdingbar. Für uns Christen stellt sich darüber hinaus die Frage: „Gott – wer ist das? Wie ist er – auch: Ist ER? Sagt auch er von sich „Ich bin …“, damit Begegnung mit ihm stattfinden kann?
Das Alte Testament beantwortet diese Frage im Buch Exodus. EX 3,14: „Der brennende Dornbusch“. Gott offenbart sich Mose als der ICH-BIN-DA. Gottes Wesen ist es, da zu sein. Er ist der Seiende schlechthin und als dieser ist er auch für uns Menschen da. Durch diese Selbstoffenbarung wird es Mose möglich zu sagen, wer ihn gesandt hat. Erst durch die Offenbarung wird Gott „mitteilbar“. Alle weiteren Beschreibungen und Bilder für Gott in der Bibel (Wasser, Licht, Brot, Guter Hirte …) zeigen auf, dass es einen einzigen Gott gibt und wie er sich zur Welt verhält. Die verwendeten Bilder sind ein Versuch, etwas von Gottes Wesen zu offenbaren, auf die Frage nach dem Wer bist DU? zu antworten. Allen Bildern zu eigen ist, dass sie nur ein Bruchstück vom Wesen Gottes aufzeigen. Gott ist so, aber er ist zugleich auch der ganz andere, der Fremde und Unfassbare.
In der Person Jesu findet die Selbstoffenbarung Gottes als der ICH-BIN-DA und die Erwartung der Menschen auf das Kommen des verheißenen Retters ihre Vollendung. Gott kommt den Menschen in Jesus Christus in einer Art und Weise nahe, die nicht zu überbieten ist. Er wird Mensch, einer von uns. Dies erlebten die ersten Christen in der direkten Begegnung mit Christus, dies können auch wir heute erfahren: in der Begegnung mit Menschen, aus der Beschäftigung mit der Heiluigen Schrift.
Die sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium, um die es heute geht, wollen in besonderer Weise deutlich machen, wer und wie Gott zu uns Menschen ist. Bei Johannes geht es um eine Identifizierung Jesu Christi mit dem Inhalt des jeweiligen Bildes, nicht um ein bloßes Gleichnis für Christus. Der Inhalt ist bei allen Bildern derselbe: Das Leben und die Frage an jeden einzelnen: Wer ist Gott für dich! Das Ich-bin gibt dafür Glauben und Vertrauen. Wer erkannt hat, wer Jesus und wer damit Gott ist und für ihn ist, wie nah Gott uns ist und wie sehr er sich um uns sorgt, der muss diese Erkenntnis verlebendigen, in sein Leben umsetzen und andere daran teilhaben lassen.
Die Bilder stammen alle aus dem Alltagsleben Jesu und waren für die Menschen seiner Zeit eingängig und verständlich. Für uns heute sind einige verständlich, andere dagegen fremd, oder ihre Aussagkraft hat sich verändert. Gemeinsam ist den sieben Ich-bin-Worten ihr Aufbau: auf die Selbstvorstellung „Ich bin …“ (Ich bin der Weinstock) folgt die Konsequenz, d.h. eine Aufforderung zum Tun – Wer in mir bleibt. Diese mündet dann ein in eine Verheißung: bringt reiche Frucht.
Das Bild des Weinstocks ist sicherlich den meisten von uns fremd. Wer kennt sich schon im Weinbau aus, hat schon einmal einen Weinstock gesehen, weiß, welche Arbeit und Mühe für die Pflege eines Weinberges notwendig ist. Und doch verbindet jeder bestimmte Gedanken und Vorstellungen damit, wenn er dieses Wort hört. Wer schon einmal selbst im Weinberg gearbeitet hat, wird dieses Bild plötzlich ganz neu verstehen. Für mich, die ich bis zu meinem Klostereintritt nie etwas mit Weinbau zu tun hatte, begann das Weinstockbild sehr lebendig zu werden, als ich die verschiedenen Arbeiten zum ersten Mal selbst gemacht habe. Ich möchte Ihnen nun aus meinen eigenen Erfahrungen etwas über die Arbeiten im Weinberg erzählen.
Das Bild des Weinstocks und Weinbergs ist in der Bibel ein sehr wichtiges und zentrales. Es sind nicht wenige Stellen, gerade im Alten Testament, die davon sprechen. Nimmt man alle Wörter, die mit Wein zu tun haben, kommt man auf 513 Stellen, allein der Begriff Wein kommt 54 mal vor.
Was ich ihnen über die Weinbergsarbeit erzähle, beruht auf dem heutigen Stand. Vieles hat sich seit der Zeit Jesu leicht verändert.
Der Weinstock ist eine Kletterpflanze, die nach Möglichkeit ein Spalier oder eine andere Vorrichtung braucht, an der sie hochklettern kann. So pflanzte man zurzeit Jesu oft einen Feigenbaum und eine Rebe nebeneinander (1Kön: … und jeder saß unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum, solange Salomo lebte). Die Rebe besteht aus mehreren Teilen: Die Wurzeln, die den Rebstock mit Wasser versorgen, reichen oft metertief in die Erde. Auch in trockenen Gebieten oder in sehr trockenen Jahren, kann die Rebe somit gut überleben. Der Rebstamm, der 30-40 Jahre, sogar bis zu 80 Jahre alt werden kann, besteht aus sehr hartem Holz. An ihm wachsen die Reben, die dann die Trauben tragen.
Wird ein neuer Weinberg angelegt, muss zuerst der Boden bereitet werden. Die Fläche liegt ein, zwei Jahre brach. Dann wird die Fläche umgegraben, neue Erde aufgeschüttet, Steine entfernt und das Ganze fein säuberlich geebnet. Jeder Weinstock erhält den gleichen Standraum, genügend Platz, damit er alles Notwendige in ausreichendem Masse hat. (Jer 2,21: … ich aber hatte dich als Edelrebe gepflanzt, als gutes, edles Gewächs; Ez 17, 8: … er war doch auf guten Boden gepflanzt, an reichlich fließendem Wasser, um Zweige zu treiben und Früchte zu tragen und ein herrlicher Weinstock zu werden).
Ein Jungfeld braucht viel Pflege: Stöcke gießen, Unkraut hacken, Boden lockern. Die dünnen Stämmchen bindet man an Stützpfählen an, damit sie gerade wachsen und bei Sturm und Unwetter nicht abknicken. Alle Triebe, die am jungen Stock wachsen, werden bis auf zwei entfernt. Der Stock soll sich darauf konzentrieren, einen geraden, kräftigen Stamm zu bilden; Frucht zu bringen, ist erst später seine Aufgabe. Aus Holzpfählen und Draht wird eine Unterstützungsvorrichtung angelegt, die den Reben Halt bietet. Drei Jahre lässt man dem jungen Stock Zeit, sorgt sich um jeden Stock einzeln. Manche Winzer reden mit ihren Weinstöcken, damit sie gut gedeihen … (Ez 17,6: … und er wuchs heran und wurde zum üppigen Weinstock. Erst dann trägt er das erste Mal. Er darf aber nicht zu viele Trauben tragen, damit er seine Kraft für viele Jahre einteilt, überflüssige schneidet man ab.
Zurzeit Jesu war es oft üblich, den Weinberg mit einer Mauer zu umgeben, damit Tiere nicht die Früchte fraßen, aber auch, um vor Diebstahl der Trauben sicher zu sein. Zur Bewachung wurde eine Hütte oder gar ein Wachturm gebaut, in den zur Zeit der Traubenreife der Winzer zog und so seinen Weinberg bis zur Lese bewachte. Heute ist dies nicht mehr üblich.
Hat man nun alle Mühe und Sorgfalt bei der Pflanzung eines Weinberges angewandt, kann man sich nicht zur Ruhe setzen, vielmehr wiederholen sich Jahr für Jahr viele notwendige Arbeiten damit der Weinberg seinen Ertrag bringt (PS 80,5: … sorge für diesen Weinstock).
Im Winter, wenn die Reben ruhen, beginnt das Schneiden der Reben. Ohne beschneiden, würde der Rebstock wild wuchern und keine Trauben tragen. Bis auf einen Rebzweig, der ausgewählt wird, um die Frucht zu tragen, werden alle anderen abgeschnitten. Nach dem Schneiden erfolgt das sogenannte Ausheben. Alle übrigen Rebzweige müssen aus dem Stützdraht herausgezogen werden, damit die neuen Triebe Platz und Halt bekommen. Dies geschieht von Hand. Dafür braucht man oft Kraft und eine Schere, denn die Rebzweige klammern sich fest an den Draht. Die trockenen Rebzweige werden gesammelt, aus dem Weinberg herausgetragen und verbrannt. Das Holz ist zu nichts anderem zu gebrauchen.
Beginnt der Fruchtsaft in die Rebzweige zu steigen, geht der Winzer zum Gerten in die Weinberge. Die Fruchtrute wird um einen der Drähte gebogen und festgebunden. Sinn dieser Arbeit ist es, die wachsende Rebe in eine Form zu bringen. Diese erleichtert es später die Trauben zu ernten und während des Jahres notwendige Arbeiten schneller zu erledigen. Wieder wendet sich der Winzer jedem einzelnen Weinstock zu. Er muss die Fruchtruten vorsichtig biegen, denn sie brechen schnell ab. Mitte bis Ende April beginnen die Reben auszutreiben. Tag für Tag kann man ihnen beim Wachsen zu schauen (Jes 24,17: Wie ein Weinstock trieb ich schöne Ranken, meine Blüten wurden zu prächtiger und reicher Frucht). Ca. 2-4 Wochen nach dem Austrieb beginnt das Ausbrechen. Man wundert sich, wie aus dem so tot wirkenden alten Stammholz, junge grüne Triebe wachsen können. Diese müssen entfernt werden, der Stock soll seine Energie nicht verschwenden, sondern in die Fruchtruten konzentrieren. Auch würde der Rebstock zu einem üppigen Strauch verkommen, an dem keine oder nur ganz kleine Trauben zu finden wären. Die Triebe werden von Hand entfernt. Da diese Arbeit nur in gebückter Haltung gemacht werden kann, ist sie gerade an heißen Tagen sehr anstrengend.
Sind die Triebe ca. 50 cm lang, werden sie geheftet. Die jungen Triebe werden von Hand in den Drahtrahmen eingesteckt. Zwei bis dreimal geht man durch die Weinberge, um den jungen Trieben durch das Einstecken Halt zu geben, denn gerade die grünen Triebe sind sehr empfindlich. Täte man dies nicht, würden sie bei Wind oder starkem Regen einfach abbrechen. Diese Arbeit ist zeitaufwendig, muss aber schnell geschehen, da zu dieser Jahreszeit plötzlich auftretende Gewitter einen ganzen Weinberg zerstören können (PS 78,47: … ihre Reben zerschlug er mit Hagel).
Im Sommer dann ist der einzelne Weinstock kaum vom anderen zu unterscheiden. Die Reben bilden eine grüne Laubwand, in der jeder Stock untergeht. Dieses Laub muss mehrfach geschnitten werden, damit die Rebe ihre Kräfte zur Ausbildung der Trauben gebraucht und nicht für ein unendliches Längenwachstum der Triebe. Der Winzer muss regelmäßig seine Weinberge mit wachen Augen kontrollieren, damit nicht Pilzbefall, Schädlinge oder Nährstoffmangel die Arbeit zu Nichte machen. Immer wieder muss der Boden aufgelockert, die Begrünung zwischen den Zeilen geschnitten, das Unkraut zwischen und unter den Stöcken kurz gehalten werden.
Dann blühen die Reben (Hld 2,13: … die blühenden Reben duften). Es ist eine risikoreiche Zeit, denn starker Regen oder Hagel gefährden die Blüte. Die Rebblüte selbst ist eigentlich unscheinbar, aber sie verbreitet einen feinen, intensiv süßlichen Duft ganz eigener Art. Nach der Blüte lässt sich das weitere Wachsen der Trauben gut verfolgen (Weish 51,15: … und wie nach dem Blühen die Trauben reifen). Haben die Beeren eine solch prächtige, geschlossene Traube gebildet, braucht es Sonne und trockenes Wetter, damit genügend Zucker in den Beeren entsteht. Das Wetter spielt eine wichtige Rolle, der richtige Lesezeitpunkt eine weitere. Er muss mit Glück und einem guten Blick auf die Qualität der Trauben gefunden werden. (Jes 62,9: Schick deine scharfe Sichel aus, und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde; wer den Wein geerntet hat, soll ihn auch trinken). Jede Traube wird von Hand abgeschnitten, in einen Leseeimer geworfen. Dann kommt sie in den Legel und wird aus dem Weinberg getragen, dann auf den Traubenwagen geschüttet. Zu Hause wird der Wein gekeltert. Nach der Kelterung reift der Wein langsam heran und bedarf der ständigen Kontrolle und Umsorgung. Heute wird vermehrt maschinell gelesen. Die Arbeit der Lese und die damit verbundene Freude über die heimgebrachte Ernte, verliert ihren gemeinschaftlichen Charakter, gleichzeitig auch die Erfahrung, wie schwer es sein kann, in Kälte oder gar bei Regen zu lesen. Bei uns im Kloster ist die Lese, zu der immer viele Helfer und Freunde kommen, auch eine Art Fest. Es ist schön, die Ernte gemeinsam einzuholen und so die Mühe eines Jahres zu vollenden.
Der Weinstock hat nun seine Hauptaufgabe erfüllt. Die herbstlichen Tage mit Sonne und Wärme nutzt er, um Energien für den Winter im Holz einzuspeichern und für das nächste Jahr gerüstet zu sein. Langsam fällt der Fruchtsaft wieder, die Blätter fallen und bald schon kann der Winzer den Rebstock aufs Neue beschneiden, damit er im nächsten Jahr wieder reiche Frucht bringen kann.
Bibelarbeit zu Joh 15, 1-8
Fragen als Anregung, sich mit dem Text intensiver zu beschäftigen:
– Welche Verben werden genannt, von welchen Tätigkeiten wird gesprochen? (abschneiden, reinigen, wegwerfen, verbrennen, in ihm bleiben, Frucht bringen)
– Womit könnte ich sie in meinem/unserem Leben vergleichen, was bedeuten sie für mich?
– Was sagt mir das Bild des Weinstocks, des Weinberges? Wer ist Gott als Vater Jesu Christi für mich / für uns?
– Was wird über Christus gesagt und das Verhältnis zu seinen Jüngern?
– Wer ist Christus für mich im Hinblick auf das Bild des Weinstockes: hänge ich wirklich an ihm, bleibe ich in ihm? Wie sieht das konkret im Alltag aus?
– Stichwort bleiben: Was bedeutet dieses „Bleibt in mir“? Wie sieht das in meinem Leben aus? Wodurch geschieht Trennung von Christus?
– Versuchen Sie in einem Satz zusammenzufassen, worin für Sie die Hauptaussage des Textes besteht.
Stichworte für mich selbst:
- Jesus allein ist der Erlöser gegenüber den vielen falschen Erlösergestalten, die nur vorgeben, es zu sein;
- nur in Jesus selbst ist all das zu finden, was dem Menschen das Leben ermöglicht;
- es geht um den Ursprung des Lebens schlechthin, der im Orient im Baum bzw. Weinstock als Urbild sichtbar und anschaulich wurde;
- Gott allein ist der Winzer, er kontrolliert Wachstum und Fruchtbringen;
- Fruchtbringen ist nicht aus eigener Kraft möglich, sondern nur in Verbundenheit mit Christus; Jesus als tragender Grund für ein fruchtbares Leben;
- aus der geschenkten Gemeinschaft mit Christus erwächst eine Verpflichtung;
- Wachstum, d.h. ein mehr an Glauben, ist mit Reinigen verbunden; Stillstand bedeutet abgeschnitten werden;
- Mahnung zum Bleiben nicht als mystische Versenkung gemeint, sondern im Leben fruchtbar zu werden für … d. h. leben in Gemeinschaft mit Christus.
Von Sr. Thekla Baumgart OSB