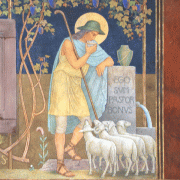Der große Bogen des Anfang(en)s in der Heiligen Schrift und in der Benediktsregel
Im ersten Kapitel des ersten Buches der Heiligen Schrift und im letzten Kapitel des letzten Buches der Heiligen Schrift ist vom „Anfang“ die Rede: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, so sagt uns das Buch Genesis (Gen 1,1). Und am Schluss, in der Offenbarung des Johannes, spricht Gott selbst direkt zu uns: „Siehe, ich komme bald. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“ (Apk 22, 13). In einem großen, geradezu kosmischen Bogen ist hier die ganze Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zur Vollendung in diesem einen Wort vom „Anfang“ zusammengefasst – ein grandioses Szenarium eröffnet sich uns da, und unserer bescheidener Anfang miteinander hier und heute wird auf einmal unendlich groß, ist eingebettet in Gottes Ewigkeit.
Unseren Anfang setzen wir uns nicht selbst – wir wurden angefangen sozusagen, hineingeboren in eine Welt, die schon war. Gott selbst hat uns ins Dasein gerufen, hat uns unseren Anfang geschenkt – aus reiner Gnade und aus reiner Liebe. Und dieser Anfang ist kein einmaliges Geschehen – das ist das Großartige an ihm. Es ist ein Prozess, ein ewiges und immer neues Wachsen und Reifen von Anfang zu Anfang.
Der jüdische Schriftsteller Felix Braun hat dies in einem wunderbaren Gedicht mit dem Titel „Ewigkeit“ einst so beschrieben:
„Uralt bin ich – vom Anfang komm ich her –
Nun müd von tausendfältiger Gestalt.
Mein Los ist: jedes Blatt zu sein im Wald.
Mein Los ist: jede Welle sein im Meer.
Ich leb von von Anfang zu Anfang,
von Wiederkehr zu Wiederkehr.
Nehm stets in anderm Atem Aufenthalt.
So leb ich schwebend: weder hier noch dort.
Und schaudre, dass ich mich so oft verlor
Und immer wieder fand: in diesem Wort.
Von Anfang zu Anfang bis in Ewigkeit.“
Hören Sie die Anklänge an die Doxologie heraus, die wir und die ganze Kirche seit ihren Anfängen Tag für Tag so oft und immer wieder beten: „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist – wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.“ Kein geringerer als der dreifaltige Gott selbst ist unser Anfang und unser Ziel, unsere Sehnsucht und unsere Erfüllung, unsere Zeit und unsere Ewigkeit. „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, im Anfang auch, so heißt es im Prolog zum Johannesevangelium „Im Anfang war das Wort“, das Leben spendende Wort, das menschgewordene Wort Jesus Christus. Und auch der Heilige Geist, so berichtet uns die Apostelgeschichte im Kap. 11,15 „kam von Anfang an auf uns herab“, so wie einst im Anfang Gottes Geist über den Wassern schwebte (Gen 1,2).
Schauen wir auf den lateinischen Bibeltext, so fällt auf, dass es zwei Begriffe für „Anfang“ gibt: „initium“ und „principium“. Initium ist dabei immer der einmalig gesetzte Anfang – principium aber der Anfang, der sich wie ein roter Faden durch die ganze Schöpfungs- und Erlösungsgeschichte hindurchzieht, der immer wieder neu zum Aufbruch einlädt, der Gottes Anfang sozusagen zum Seinsprinzip werden lässt: „sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum“.
Ebenso wie die Heiligen Schrift so ist auch die Regel des hl. Benedikt vom „Anfangen“ gleichsam umfangen. Im ersten und im letzten Kapitel der Regel ist vom Anfang die Rede. Im Prolog, Vers 4 heißt es: „Sooft du etwas Gutes zu tun beginnst [d.h. anfängst], bitte zuerst inständig darum, dass er [Gott] es vollende“. Hier ist er wieder, der Gedanke, dass wir es aus eigener Kraft eben nicht vermögen, dass allein die Gnade Gottes uns zum Anfangen bewegt und dass nur Er allein es ist, der unser Tun vollenden kann. Wir sind und bleiben auf Gottes vorausgehende Liebe und auf seine Hilfe angewiesen. Die Spannung zwischen der Freiheit des Menschen und seinem Angewiesensein auf die Barmherzigkeit Gottes bleibt immer bestehen.
Ihren ganz und gar authentischen Ausdruck findet diese Spannung in dem Ruf: „O Gott, komm mir zu Hilfe – Herr, eile mir zu helfen. Deus, in adiutorium meum intende; Domine, ad adiuvandum me festina“. Siebenmal am Tag beten wir diesen Flehruf am Anfang jeder Hore. Sie prägt sozusagen den Anfang unseres Betens. Nicht umsonst haben die Mönchs- und Wüstenväter ihren Schülern und damit auch uns diesen Ruf als immerwährendes Gebet empfohlen. Es ist ein Gebetsruf voller Kraft und voller Weisheit, ein Ausdruck wahrer Demut vor der Größe Gottes, ein Wissen um die eigene Begrenztheit, ein vertrauensvolles Sich-Hineinbegeben in die Hände Gottes.
Im letzten, dem 73. Kapitel der Regel sagt der hl. Benedikt: „Diese bescheidene Regel haben wir für Anfänger geschrieben“ (RB 73,8), damit wir durch ihre Beobachtung „einen Anfang im klösterlichen Leben bekunden“ (RB 73,1). Zweimal ist hier am Schluss noch einmal vom Anfangen die Rede, fast so, als solle sich ein geheimnisvoller Kreislauf vollenden. Diesen geheimnisvollen Kreislauf hat Silja Walter einmal in einem kurzen Gedicht ganz wunderbar beschrieben:
ANFANG
Habe ich also die Regel
bis ans Ende gelebt,
dann bin ich ein vollendeter
Anfänger oder endlich ein
Anfänger geworden, endlich
nichts als ein aus dem
Anfang lebender Mensch.“
Im Regelkommentar der Salzburger Äbtekonferenz heißt es zu der eben genannten Stelle aus dem 73. Kapitel der Benediktsregel:
„Mit der Wendung vom Anfang im klösterlichen Leben schwächt der hl. Benedikt seine Regel nicht ab und meint nicht den Anfänger im klösterlichen Leben, sondern den Mönch, der angesichts der Weisung Christi zu Gerechtigkeit und Vollkommenheit immer und ein Leben lang einen Anfang machen muss … Benedikt steht mit dieser Formulierung vor allem in der Tradition der Wüstenväter, wo das Bewusstsein vom Anfangen zu immer neu vollzogener Umkehr führt.“ In diesem Sinne gehört das Immer-neu-anfangen in der Tat ganz eng und unmittelbar zu unserer Berufung. Es ist der Kerngedanke unseres Gelübdes der „Conversatio morum“ – des klösterlichen Lebenswandels, das uns auffordert, jeden tag neu zu beginnen.
Wir sehen also, dass der Gedanke des Anfangs und des Anfangens die ganze Heilige Schrift und auch die ganze Benediktsregel durchzieht. Anfangen wird so zum Leitfaden für ein christliches und auch für ein benediktinisches Leben. Christliches und auch benediktinisches Leben aber ist ganz und gar österliches Leben. Ohne Ostern, ohne den Glauben an die Auferstehung, wäre unser Leben sinnlos. Nur, wenn wir österliche Menschen werden, so werden wir auch wirklich Menschen des Anfangs. Denn Ostern, so sagt Karl Rahner, „Ostern ist der Anfang der Vollendung. Ostern proklamiert einen Anfang, der schon über die fernste Zukunft entschieden hat. Auferstehung sagt: der Anfang der Herrlichkeit hat schon begonnen. Und was so begonnen hat, das ist daran, sich zu vollenden …“
Sie waren auch nur Anfänger: Menschen der Bibel als Leitbilder des Anfangs
Betrachten wir nun in einem zweiten Schritt sieben biblische Gestalten des Anfangs. In den Menschen, die im Alten Testament Jahwe und im Neuen Testament Jesus begegnen, bricht etwas auf. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott fordert sie heraus, öffnet sie für ein neues Leben, ja macht sie zu neuen Menschen. Der Anfang, den die Begegnung mit Gott und mit Jesus Christus, seinem Sohn, in Menschen bewirkt, ist immer zugleich Scheidung und Entscheidung. Eine ganze Spannweite von Reaktionen – von der Hingabe und Nachfolge bis zum Zweifel und zur völligen Ablehnung – findet sich in der Heiligen Schrift. Es gibt viele Möglichkeiten anzufangen – oder auch, den Anfang zu verpassen. In der ein oder anderen Gestalt des Anfängers können wir uns selbst, unsere Eigenart und Eigen-heiten vielleicht wiederfinden. Vielleicht können wir von diesen Menschen, die vor uns anfingen, auch lernen, können uns Mut zusprechen lassen, den Aufbruch immer neu zu wagen.
Abraham – „Sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet“ (Röm 4,9)
Zu den ganz großen Gestalten des Anfangs gehört Abraham. „Zieh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde! Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein… Da zog Abraham fort, wie ihm Jahwe befohlen hatte. Er war fünfundsiebzig Jahre alt, als er von Haran wegzog. Abraham nahm seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und all ihre Habe, die sie besaßen. Dann brachen sie auf, um in das Land Kanaan zu ziehen (Gen 12,1-4).
Ein eindeutiger und unkomplizierter Anfang: dem Ruf Gottes folgt die Tat, ohne Zögern und Zaudern. Solches Hören und Gehorchen hatte der hl. Benedikt wohl vor Augen, als er sein Kapitel über den Gehorsam niederschrieb: „Die höchste Stufe der Demut ist der Gehorsam ohne Zögern … Wie in einem einzigen Augenblick folgt in der Schnelligkeit der Gottesfurcht beides sofort aufeinander: der ergangene Befehl des Meisters und die ausgeführte Tat des Jüngers.“ (RB 5,1 und 9).
Abraham glaubte dem Anruf Gottes und glaubte der Verheißung, die an ihn erging. Und er machte sich auf den Weg – obwohl er bereits 75 Jahre alt war. Wer weiß: vielleicht hat er wie später nach ihm der greise Simeon oder die alte Witwe Hanna sein Leben lang auf diesen Anruf gewartet. Und heute und jetzt ist er bereit, sich auf den Weg zu machen und alle Sicherungen des Lebens hinter sich zu lassen. Zum Anfangen gehört das Loslassen, das Hinter-sich-lassen. Wer einmal die Hand an den Pflug gelegt hat, soll nicht zurückschauen – oder wie es beim hl. Benedikt in Kap. 58,24 heißt: „Der Novize soll nichts für sich zurückbehalten – nihil sibi reservans ex omnibus“.
Jeremia – „Ach Herr, ich weiß nicht zu reden, ich bin zu jung“ (Jer 1,6)
Der Anfang des Propheten Jeremia könnte fast eine Art Gegenbild zu dem des Abraham sein. Jahwes Wort und Ruf erging an Jeremia – und dieser hat Angst: „Ach, Herr, ich weiß nicht zu reden, ich bin zu jung“. Er traut es sich nicht zu, er zögert und er verhandelt mit Jahwe, seinem Gott. Zweimal muss Jahwe ihm sagen: „Hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.“ (Jer 1,8; 1,17). Erst danach begreift Jeremia, was an ihm geschehen ist und lässt sich in Dienst nehmen. Ein Prophet wider willen, könnte man sagen – ein Anfänger, dem zuerst einmal das Wörtchen „Aber“ über die Lippen kommt, weil er ob seines jugendlichen Alters unsicher, vielleicht auch schüchtern ist und wenig Selbstbewusstsein hat. Vielen von uns mag Jeremia mit seinen Zweifeln zunächst näher liegen als Abraham, der so unzweideutig und souverän den neuen Anfang gewagt hat.
Für den hl. Benedikt spielte das Alter für die Berufung zum Neuanfang – wie wir wissen – ebenso wenig eine Rolle wie einst für Jahwe. „Nirgendwo im Kloster darf das natürliche Alter die Rangordnung bestimmen oder beeinflussen. Haben doch Samuel und Daniel, obgleich sie noch jung waren, über Alte Gericht gehalten.“ (RB 63,5.6) Und im Abtskapitel 64,2 heißt es: “Man soll aber den wählen und einsetzen, der verdienstvolles Leben und Lehrweisheit verbindet, wenn er auch in der Rangordnung der Klostergemeinde der Letzte wäre.“ Nicht das Alter ist entscheidend, sondern der Ruf des Herrn, der jedem Anfang vorausgeht. Wen Gott ruft, dem gibt er auch die Kraft zum Anfangen – gegen alle Angst und gegen alle inneren Widerstände.
Der reiche Jüngling – „Und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen“ (Mk 10,22)
Gott gibt die Kraft zum Anfangen, aber er übt keinen Zwang aus. Unsere menschliche Freiheit reicht so weit, dass wir auch Nein sagen und den Anfang verweigern können. Dafür ist der reiche Jüngling ein sprechendes Beispiel. Was Jesus vom reichen Jüngling erwartet, ist nicht nur viel, sondern alles: “Geh, verkaufe alles, was du hast … dann komm und folge mir nach“. „Er hatte ein großes Vermögen“, heißt es dann. Und dieses Vermögen war sicher nicht nur Geld. Besitzen können wir ja unendlich vieles: Einfluss, Ansehen, Macht, bestimmte Fähigkeiten, Beziehungen, eine soziale Stellung. Dies alles aufzugeben und neu anzufangen ist unendlich schwer. Auch dann, wenn wir wirklich auf der Suche sind. Der reiche Jüngling war ein Suchender, der im Grunde genommen kurz vor dem Durchbruch stand. Das hat Jesus ganz sicher gewusst. Denn nicht umsonst heißt es ja: „Da sah Jesus ihn an, und weil er ihn liebte, sagte er: eines fehlt dir noch…“ Echte Liebe fordert Ganzhingabe. Sie kann sich nicht mit Halbheiten zufrieden geben. Der reiche Jüngling geht traurig weg. Er will neu werden, kann aber vom Alten nicht lassen. So verpasst er den Kairos, den Anfang eines neuen Lebens. Fragen wir uns einmal, was wohl das eine ist, das uns noch fehlt. Wenn wir wirklich anfangen wollen, dann müssen wir dieses Eine heraus-finden und uns Stück für Stück von ihm zu lösen versuchen.
Im 33. Kapitel der Benediktusregel ist ebenfalls vom Loslassen von Eigentum die Rede – und auch hier ist keineswegs nur der materielle Besitz gemeint. Hier in diesem Kapitel wird der hl. Benedikt im wahrsten Sinne des Wortes radikal: „hoc vitium radicitus amputandum est“. Er nennt den Eigenbesitz ein Laster, das radikal, d.h. mit der Wurzel ausgerissen werden muss. Erst dann werden wir frei – frei für Gott und frei für die Gemeinschaft: „Alles sei allen gemeinsam, so dass niemand etwas sein Eigentum nennt oder es als solches beansprucht“. (RB 33,6). Und vom Novizen wird vor der Profess verlangt:“ Wenn er Vermögen hat, soll er es vorher an die Armen verteilen oder es in einer feierlichen Schenkung dem Kloster vermachen.“(RB 58,24)
Petrus – „Er bekam Angst und begann unterzugehen“ (Mt 14,30)
Petrus ist in vieler Hinsicht eine typische Anfangs-Gestalt. Schon bei seiner Berufung am See von Galiläa hat er gezeigt, dass er ein Mann der schnellen Entschlüsse war. Jesus ruft sie, und Petrus und sein Bruder Andreas lassen buchstäblich alles stehen und liegen und folgen dem Herrn. Menschen, die spontan Ja sagen und sich bereitwillig engagieren, sind herzerfrischend. Manche mögen sich fragen: ist solch ein Anfang überhaupt verantwortbar? Doch täuschen wir uns nicht: nicht jeder schnelle Entschluss und spontane Anfang wird später bereut – dafür gibt es in unserer Gemeinschaft durchaus eindrucksvolle Beispiele.
Auch Petrus hat seinen Anfang in Galiläa nie bereut. Aber er hat im Laufe seines Weges der Nachfolge den ein oder anderen „Dämpfer“ erhalten. So bei seinem nächtlichen Gang über den See. Voller Begeisterung stieg er da aus dem Boot und wollte seinem Herrn und Meister auf dem Wasser entgegengehen. „Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen“. Übermut und Leichtsinn hatten ihn gepackt, er hatte sich zuviel zugetraut. Dem Sturm, womöglich dem Gegenwind, war er nicht mehr gewachsen. Und dann kam die Angst, und die Hochgemutheit des Anfangs war wie weggeblasen. Warum habe ich das alles nur angefangen, mag er sich gefragt haben. Wer einen Anfang macht, muss auch den Mut haben, Schluss zu machen, wenn er erkennt, dass er sich geirrt oder verrannt hat. Petrus hatte diesen Mut und war auch nicht zu stolz, seinen Herrn um Hilfe anzuflehen. „Jesus streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn“ – ist das nicht ein wunderbar tröstlicher Gedanke? Gott rettet uns, wenn wir uns verrannt haben – wir müssen ihn nur darum bitten.
In der Vita des hl. Benedikt (Kap. 7) gibt es die bekannte Geschichte von Maurus, der auf Geheiß seines Meisters Benedikt über das Wasser geht und den kleinen Placidus vor dem Ertrinken rettet. Diese Geschichte ist der Matthäus-Perikope vom Gang des Petrus über den See nachempfunden. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie entdecken, dass es zwischen beiden Erzählungen einen kleinen, aber sehr bedeutsamen Unterschied gibt. Während Petrus vom Herrn selbst gerettet wird, schickt der hl. Benedikt seinen Schüler Maurus. Dieser, so heißt es „erbat und empfing den Segen und lief auf Befehl seines Abtes“, um den kleinen Placidus zu retten. Hier kommt – wie wir sehen – der Gedanke der Stellvertretung in den Blick. Der Segen des Abtes Benedikt bewirkt das Wunder – nicht das eigene Vermögen des Maurus. Wir können also auch einander wunderbare Start-Helfer sein und zum Retter werden, wenn der Anfang auch einmal misslingt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir an die Vollmacht Gottes glauben und uns von ihm wie ein Werkzeug in Dienst nehmen lassen.
Der jüngere Sohn des barmherzigen Vaters – „Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen“ (Lk 15,18)
Ein unübertrefflicher Neuanfang ist in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. vom barmherzigen Vater beschrieben. Aus jugendlichem Freiheitsdrang heraus hat der Sohn die als zu eng empfundene Heimat verlassen. Er ist ausgebrochen aus alten Konventionen und und scheinbar fesselnden Bindungen. In der Fremde will er ganz von vorne anfangen. Doch er kann keine neuen Wurzeln schlagen, sondern bleibt ein Fremder in einem fernen Land. „Es ging ihm sehr schlecht“, schreibt der Evangelist nüchtern und schonungslos. Diese neue und unerwartete Erfahrung bringt ihn dazu, sich zu erinnern und an das zu denken, was er leichtfertig verlassen hat. Aus dem wehmütigen Blick zurück entstehen in einem zweiten Schritt Einsicht und Reue. Da ging er in sich, wörtlich: da kehrte er zu sich selbst zurück. Dann die Entscheidung: “Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen“. Der Aufbruch des Sohnes ist Rückkehr und Heimkehr. Zu einem echten Neuanfang aber kommt es erst durch die Aufnahme und Annahme des Vaters:“ Der Vater sah ihn schon von weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn“ (Lk 15,20). Einen wirklich neuen Anfang, der neues Leben verheißt und Vergebung können wir uns nicht selbst geben. Der Mensch kann umkehren, er kann aufbrechen und neu anfangen. Ob er aber ankommt und angenommen wird, das steht nicht in seiner Macht. Ein solcher Anfang kann ihm nur vom liebenden und barmherzigen Vater geschenkt werden.
Die Benediktusregel sieht im Abt u.a. auch ein Abbild dieses barmherzigen Vaters. Im 27. Kapitel (für mich eines der schönsten der ganzen Regel) ist beschrieben, wie der Abt mit einem sich verfehlenden Bruder umgehen soll. „Er hatte solches Mitleid mit dessen Schwäche, dass er ihn huldvoll auf seine heiligen Schultern nahm und so zur Herde zurücktrug“ (RB 27,9) Der barmherzige Vater, der zugleich der gute Hirte ist, gewährt dem Sünder immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr und zum Neuanfang. Einsicht und Reue werden dabei als selbstverständlich vorausgesetzt. Denn nur so können auch Buße und Strafe als heilsam verstanden werden. Denn letztlich geht es immer um das Heil des Menschen. Deshalb lauten auch die letzten Worte der sogenannten Strafkapitel 23-30: „Ut sanentur – damit sie geheilt werden“.
Maria – „Mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38)
Als letzte möchte ich Ihnen die Gottesmutter Maria als Leitgestalt des Anfangs vor Augen stellen. In dem Wort „Mir geschehe“ sind Marias Anfang und ihr weiterer Lebensweg als Erfüllung dieses Anfangs eingeschlossen. Gott ist es, der den Anfang macht, der Maria erwählt und für würdig erfunden hat, seinen Sohn zur Welt zu bringen. Maria wird von Gott direkt angesprochen und ganz – mit Leib und Seele – eingefordert. Die Verheißung des Engels aber bedarf des „Fiat“, der Zustimmung, des Vertrauens und der Annahme dieses neuen Anfangs. Maria hat die Größe und die Demut zugleich, sich dem Unglaublichen zu öffnen und ihre menschliche Freiheit in den Dienst des göttlichen Heilsplanes zu stellen. So wird Gott in ihr Mensch – und sie selbst wird damit die neue Eva, der erste neue Mensch. Darin liegt ihre einzigartige Würde. Darin liegt aber auch die Zusage, dass jedes von einem Menschen, d.h. auch von uns, gesprochene „Fiat“ einen neuen und ewigen Anfang eröffnet, der uns die Erfüllung all unserer Sehnsucht verheißt.
Die Gottesmutter kann uns ein wirkliches Vorbild sein. Für unseren Zusammenhang ist es wichtig, den neuen Anfang immer dann zu entdecken, wenn es uns gelingt, die eigene Lebensplanung los zu lassen und einzuwilligen in den Lebensplan Gottes mit uns. Dies ist eine lebenslange Aufgabe. Es ist der immer neue Anfang, den es immer wieder neu gilt, in die kleine Münze des Alltags umzusetzen.
Haben Sie sich wiedererkannt in einem dieser Anfänger, vielleicht sogar in mehreren? Die Ähnlichkeiten zwischen den Menschen der Bibel und uns heutigen Menschen sind manchmal frappierend. Wahrscheinlich war das zu allen Zeiten so, denn die Bibel will ja im jeweiligen Heute gelesen und verstanden werden. Sie hält uns den Spiegel Gottes vor, der uns weiter kommen lässt auf unserem Weg der Menschwerdung.
3) Das Bleiben als Brücke zwischen Anfang und Ziel
Kehren wir nun noch einmal zu unseren grundsätzlichen Überlegungen am Anfang. zurück. „Ostern“, so hörten wir aus dem Mund Karl Rahners, „Ostern ist der Anfang der Vollendung“. Ein guter Anfang ist wichtig. Aber es gilt eben auch: Kein Anfang ohne Ende, kein Aufbruch ohne Vollendung. Seinen Sinn erhält der Anfang durch das Ziel, der Heimkehr zu Gott. Unser ganzes Leben und Streben, so sagt uns der hl. Benedikt, ist dieser Weg der Heimkehr zum Vater.
Der hl. Benedikt weist auch auf die Grundhaltungen hin, die notwendig sind, um vom guten Anfang zum Ziel zu gelangen. Allen voran nennt er das Bleiben, die Treue, das Standhalten, die Beständigkeit. Der Weg, so sagt er ganz nüchtern, „kann am Anfang nicht anders als eng sein“ (Prolog 48). Beliebiges Aufhören, immer wieder nach Neuem Ausschau-Halten verhindert den Durchbruch zum Ziel. So ist für Benedikt das Bleiben der Garant des Anfangens. Urbild des Bleibens ist dabei die Treue Gottes zu seiner Schöpfung, zu seinem auserwählten Volk: “Jahwe, dein Gott, ist der Gott; er ist der treue Gott; noch nach tausend Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten (Dtn 7,8-9). Und Paulus bekräftigt im zweiten Timotheusbrief: “Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen“ (2 Tim 2,13).
Die Heilige Schrift ist voll von Geschichten über Menschen, die treu geblieben sind und ausgeharrt haben. An ihnen wird deutlich, was das Bleiben als Brücke zwischen dem Anfangen und dem Ziel bedeutet. Im Alten Testament etwa die Gestalt der Rut, die ihrer Schwiegermutter zusagt: „Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.“ (Rut 1,16). Im Neuen Testament dann der große Bleibende, der hl. Joseph, der treu blieb, auch als er nicht verstand. Dann natürlich Maria, die geblieben ist und zusammen mit den anderen Frauen ihrem Sohn folgte bis unter das Kreuz. Sie alle können uns Vorbild und Ansporn sein auf dem Weg vom Anfang zum Ziel. Dem Bleibenden gilt am Ende Jesu Verheißung: „Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht“ (Joh 15,4-9).
Es gibt einen schönen Text von Dom Helder Camâra, der das Beginnen und das Bleiben wunderbar zusammenfasst:
„Es ist eine göttliche Gnade,
gut zu beginnen.
Es ist eine größere Gnade
auf dem Weg zu bleiben
und den Rhythmus nicht zu verlieren.
Aber die Gnade aller Gnaden ist es
sich nicht zu beugen und,
ob zerbrochen und erschöpft,
vorwärts zu gehen bis zum Ziel.“
Anfang und Ende stehen nicht in unserer Macht, sie sind Gnadengeschenk dessen, der allein Anfang und Ende, Alpha und Omega ist und der in uns vollendet, was er selbst begonnen hat. In diesem Sinne wollen wir uns gemeinsam auf den Weg machen und zu Menschen werden, die täglich neu anfangen.
Sr. Philippa Rath OSB